Unsere Oberharzer Mundart
Zugegeben, sie ist heute keine Altagssprache mehr, unsere Oberharzer Mundart. Aber sie wird nach wie vor gepflegt in speziellen Mundartkreisen, die sich für ihre Erhaltung einsetzen. Doch wie kam diese Mundart zu uns in den Oberharz? Um das zu klären müssen wir zurückgehen ungefähr ins 16. Jahrhundert, als der Oberharz besiedelt wurde und die sieben Bergstädte entstanden. Einwandernde Bergleute brachten ihre Sprache mit. Sie kamen aus allen deutschen Landen, aus dem fränkischen, mansfeldischen, thüringischen, sächsischen, niedersächsischen und vorherrschend aus dem erzgebirgischen Sprachraum. Es bildete sich die Oberharzer Mundart, mit feinen regionalen Unterschieden, die auf die Herkunft der Zuwanderer schließen lässt. Das Wort „Berg" zum Beispiel wird gesprochen wie „Barg“, „Bark“, „Barch“ oder auch „Barrich“.
Seit dem 19. Jahrhundert wird auch im Oberharz nicht mehr zu 100% flächendeckend Oberharzer Mundart gesprochen, was mit der montanwirtschaftlichen Prägung zusammenhängt. Denn die leitenden Positionen im Bergbau wurden oft mit Beamten und höheren Angestellten aus dem Kernland der Regierungsgebiete besetzt, als Preußen, Hannoveraner usw. Hinzu kommt der enge Austausch mit dem Umland, das den Oberharz mit Lebensmitteln versorgte. Dementsprechend waren Hochdeutsch und Niederdeutsch parallel auch sehr weit verbreitet.
In dem folgenden Text beleuchtet Karl Reinecke zum einen die Herkunft der Mundart, zum anderen gibt er mit einer Kurzgeschichte auch ein Beispiel der Oberharzer Sprachvariante.
Über die Herkunft der Oberharzer Mundart
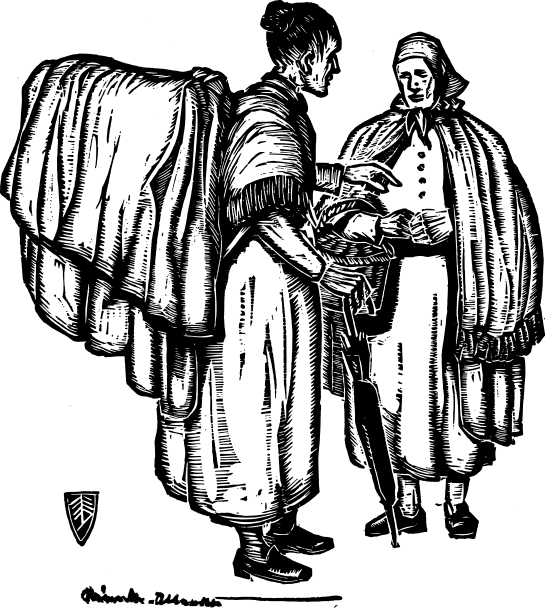
Oberharzer Kiepenfrauen
Dem Sprachtum nach gehört der größte Teil des Harzes dem Niederdeutschen an. Breit vor nahezu seinem gesamten Nordrand hin gelagert, greift es tief in das Gebirge hinein, umklammert die ganze Westseite und schiebt sich bis in den Südharz vor. Etwa in der Gegend von Sachsa stößt die Grenzlinie des Mitteldeutschen an den Harz. Sie überschneidet ihn in nordöstlicher Richtung ungefähr auf Ballenstedt zu. Somit wäre etwa das restliche Harzdrittel sprachlich dem Mitteldeutschen, der übrige Teil dem Niederdeutschen zuzurechnen. Beide große Sprachgebiete sind natürlich in sich nicht durchaus einheitlich gefärbt, sondern erfahren durch die verschiedensten örtlich oder landschaftlich bedingten Idiome eine bunte Vielgestaltigkeit.
In Mitten des niederdeutsch-niedersächsischen Harzes nun, von ihm umklammert und eingeschlossen, liegt jedoch noch ein dritter Sprachbereich, ein Einsprengsel oberdeutscher Herkunft und aus diesem Grunde also ein Fremdling innerhalb Norddeutschlands: das Oberharzische.
Es beschränkt sich lediglich auf die sieben Bergstädte des politischen Kreises Zellerfeld (Clausthal, Zellerfeld, Sankt Andreasberg, Lautenthal, Grund, Wildemann, Altenau) und einige Ortschaften (Hahnenklee-Bockswiese, Schulenberg) oder Siedlungen (Gemkenthal), die gleich den genannten Bergstädten ihre Entstehung dem Silberbergbau verdanken. Denn das Oberharzische ist nichts anderes, als die Sprache jener vor etwa vierhundert Jahren aus dem Erzgebirge eingewanderten Bergleute, die die letzte und bis in unsere Tage währende große Zeit des oberharzischen Bergbaus einleiteten.
Welche Ursachen hatte dieser Zuzug?
Es ist wissenswert, zuvor einiges Allgemeine über die Besiedlung des Oberharzes überhaupt zu sagen. Sie begann zweifellos bald nach der Entdeckung der Rammelsbergischen Erze bei Goslar. Vorher besaß der Harz höchstens jagdliches Interesse und war als kaiserlicher Bannforst dem Zugang größerer Volksmassen verschlossen, ganz abgesehen davon, dass seine Rauheit und Wildheit einer Ansiedlung vielfache Widerstände entgegensetzte.
Die ersten Bergleute in Goslar waren fränkischer Herkunft. Neu aufgenommenes Bergwerks pflegte, gemäß dem Sprichwort „Neu Bergwerk, neu Geschrei“, jedoch zu allen Zeiten einen Strom von Erwerbshungrigen oder auch Glücksrittern heranzuziehen. Wenn dieser Zulauf damals auch noch nicht so stark gewesen sein mag, wie in den späteren Jahrhunderten, so ist doch anzunehmen, dass bald eine Überfüllung eintrat, das Angebot die Nachfrage überstieg und so der arbeitslose Überschuss gezwungen war, sich in anderen Gegenden zu versuchen, nicht zuletzt angefeuert vielleicht von Geldgebern, die bei der Ausgabe von Anteilscheinen am Goslarer Bergbau zu kurz gekommen waren. Da die Leute richtig vermuteten, dass dort, wo am Gebirgsrand Erz steht, auch im Gebirge selber solches zu finden sein müsse, so werden bestimmt schon derzeit die ersten Knappen auch auf den Oberharz hinauf gewandert sein. Fest steht, dass das etwa im 11. Jahrhundert gegründete Kloster Cella (in der Gegend des heutigen Zellerfeld) als Bergherr auftrat und dass die oberharzischen Bergleute als die „Weisen Waldleute“ im bergrechtlichen und bergkundlichen Fragen beim Goslarer Berggericht in hohem Ansehen standen und häufig zu den Beratungen des „Sechsmann“. der obersten Bergbehörde, herangezogen wurden.
Mit den Bergleuten drangen Hüttenleute in das Gebirge ein. Denn Erz wird erst wertvoll durch die Verhüttung. Den Hüttengewerken bot zudem der Waldreichtum des Oberharzes billige Feuerung, sein Wasser billige Triebkraft für die Blasebälge. Köhler schlossen sich an. In die vom Land aus leicht zugänglichen Täler zogen niedersächsische Holzfäller und Eisensteingräber hinauf, sodass bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts bereits gänzlich ohne Zweifel eine, wenn auch sehr dünne, sprachlich aus Fränkisch und Niedersächsisch gemischte Bevölkerung auf dem Oberharz vorhanden gewesen ist, obgleich wir aus dieser Zeit noch keinen bestimmten Ortsnamen vernehmen. Die Leute werden eben in primitiven Waldsiedlungen um ihre Gruben herum gewohnt haben.
Die große Pest (der Schwarze Tod) hielt ein furchtbares Aufräumen unter diesen ersten Oberharzern (1348). Er rottete sie nahezu aus. Als dann auch das Kloster Cella gänzlich verfiel, verödeten Berge und Bergwerk und fielen in den Zustand der Wildnis zurück, in dem sie von nun an schliefen hundertzwanzig, hundertfünfzig oder zweihundert Jahr.
Zwar war um 1500 herum bei Grund schon wieder Eisensteinbau im Gange. Doch rührte es sich noch nicht in dem alten Silberbergbau des inneren Gebirges. Erst gegen 1520 beginnen auch dort Schlegel und Eisen von neuem aufzuklimpern und zwar nimmt der Aufgang des neuen Bergbaus seinen Anfang bei dem heutigen Andreasberg.
Die Gegend gehörte zur Grafschaft Lutterberg (Lauterberg), welche die beiden Hohnsteiner Grafen Heinrich und Hans-Ernst, Herren zu Lohra und Klettenberg, zu Lehen besaßen. Es ist belanglos, ob diese beiden von sich aus den Bergbau aufnahmen, oder ob er, von Erzgebirglern, die den Harz nach Bodenschätzen abstreiften, begonnen wurde. Bergbau war damals das Fieber der Zeit. Vermutlich befanden sich auch in der Andreasberger Gegend verlassene Baue der Alten, und der Landesherr hatte selbstverständlich Interesse daran, mindestens sein Glück zu versuchen, zumal aus den meißnischen, wie böhmischen Landen die Kunde von märchenhaften Einkünften aus dem Bergbau heraufschwirrte. Bergbau aufnehmen konnte jedoch nur mit bergverständigen, bergkundigen Leuten geschehen und diese ließen sich nur eben aus den genannten Gegenden verschreiben, aus Meißen und Böhmen, vor allem aus Annaberg und Joachimsthal, von wo derzeit die ersten silbernen Guldengroschen unter dem Namen „Joachimsthaler“ ihren klingenden Lauf durch die Welt anzutreten begannen.
Erzgebirgler also waren es, die den Silberbergbau im Oberharz von neuem aufnahmen und damit den Anfang zu einer ruhmreichen und Jahrhunderte währenden Epoche in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Oberharzes machten. Ihre ersten Gruben in Andreasberg „silberten“ so gut, dass immer neue Gewerken sich einlegten und demzufolge auch der Bedarf an Arbeitskräften sich immer mehr steigerte. Der Ruhm des jungen Oberharzer Bergbaus drang seinerzeit nun auch wieder bis ins Erzgebirge hinab, wo, wie es immer geschah, bald mehr Leute als Broterwerbsmöglichkeiten vorhanden waren. Dieser Überschuss, der sich um Annaberg, Joachimsthal, Buchholz usw. staute, folgte nun der hoffnungsfröhlichen Kunde aus dem Norden und wanderte ins „Milbokische Gebürge“, dem neuen Geschrei nach.
Es bestehen keine Einwanderungsstatistiken aus jener Zeit, und es ist gleichgültig, wie viel Tausende den Marsch in die neue Heimat antraten. Jedenfalls wird die Zuwanderung in mehr und minderer Dichte und mit gewissen Abständen Jahrzehnte lang angehalten haben. Und alle fanden das erhoffte Brot. Denn nach dem guten Einschlagen des Andreasberger Bergbaus, begann man durchweg die Baue des „Alten Mannes“ (der ersten Bergleute bis zum 14. Jahrhundert) wieder aufnehmend, sich nun auch im Wolfenbüttelschen Oberharz zu regen (Heinrich der Jüngere). Die Bergstädte Wildemann und Zellerfeld entstanden, später Lautenthal.
Dann folgte der Grubenhagensche Oberharz nach (Ernst II.). Die Bergstadt Clausthal wächst, wenn auch einem anderen Herrn untertan, als Schwesterstadt von Zellerfeld auf. Gegen 1580 dann hören wir auch von der Jüngsten der Bergstädte: Altenau. Sie alle stellen Gründungen der eingewanderten erzgebirgischen Bergleute dar, wenn sich von vornherein auch bald Niedersachsen neben ihnen niederließen, unter anderem in den durch Täler zugänglichen Ortschaften. Die niedersächsische Mundart, die diese mitbrachten, ist auch jetzt noch in vielen Familien vorhanden. Wirklich sprachbildend und sprach- und landschaftsbeherrschend jedoch, wurde das von den Erzgebirglern hereingebrachte Obersächsisch. Es besteht bis heute als oberharzische Mundart.
Ehe diese Tatsache seiner Herkunft klargestellt war, bezeichnete man das Oberharzische als Harzfränkisch, weil man es aus dem Fränkischen herleitete und sich von der ersten Besiedlung her wohl auch fränkische Sprachreste darin befinden. Der ehemalige Altenauer Pastor und Mundartdichter Georg Schulze (gestorben 1866), der die oberharzische Mundart wissenschaftlich bearbeitete und als Sprachforscher und Gewährsmann der Brüder Grimm Namen und Ruf besaß, erkannte die Herkunft nicht klar. Er hielt das Oberharzische für eine Mischung von Mansfeldisch, Fränkisch und Hennebergisch (Thüringisch). Zweifellos sind nun unter den zugewanderten Bergleuten auch Mansfelder, Thüringer, usw. gewesen, die Sprachteilchen in den Dialekt einstreuten, wie es auch von den Niedersachsen zu sagen ist. Doch blieb das Erzgebirgische beherrschend. Auch andere Beweise für die tatsächliche Herkunft des Oberharzischen aus dem Erzgebirge ließen sich (außer dem Sprachvergleich) noch in großer Zahl anführen. Viele erzgebirgische Familiennamen finden sich im Oberharz. Manche unter ihnen sind nach erzgebirgischen Orten benannt („Schönfelder“). Namen alter und bekannter Gruben wurden als glückbringend auf die Baue der neuen Heimat übertragen. Erzgebirgische Berg- und Stadtordnungen dienten als Muster der Verwaltung, usw.
Das heutige Erzgebirgische ist im allgemeinen versächselt. Demgegenüber ist das Oberharzische härter und kantiger geblieben. Bei Sprachstudien, die ich in Annaberg, Johanngeorgenstadt, Wiesental und anderen Ortschaften anstellte und mich dabei meiner Oberharzischen Mundart bediente, hielt man mich mit auffallender Übereinstimmung für einen Vogtländer.
Ich weiß also, wohin ich meine nächste Sprachforschungsreise tue.
Text: Karl Reinecke-Altenau,
entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,
Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,
Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2
Wos von Harzkaas
Do wärd suviel von Harzkorjositäten geschriehm un geschprochen. An alles Megliche denken de Leit, an Klippen un Falsen un kruckelige Beimer un wos wäß ich. Äner hot Nosherner gesahn. Dar annere hot sich mit nackichte Brockenhexen rimgeballicht. Un äner will sogar es Must hahn leichten sahn — dar Lihng-Ekel! Von sune Faxen verzehln se änn wos.
Wos ower die richting Harzkorjositäten sänn, die warn vergassen. Oder hot än änziger von eich etwa mol wos von Harzkaas gelasen? Ich gläbs net. Allerhechstens, doß in eiern Worschtbloht dr Kafmann Miller oder Schuls eich äne frische Sendung „echten Harzkäse” mundgeracht macht un eich dodrmit, wenn mr su sahn will, Hunig im dn Maul rim schmärt.
Ich will ower gleich vierwacknamme, doß disser sugenannte „Harzkäse” nischt mit Harzkaas gemän hot. „Echter Harzkäse” un Harzkaas sänn zwä Dinger, die sich net in änn Oten aussprachen lohßen.
Dos ärschte schtinkt — alle Jammer, un wie dos schtinkt! Dos annere duftet.
Ihr saht alsu, doß do wull änn Unnerschied gemacht warn muß. Un do mecht ich ahch entschieden drim gebaten hahn. Ich loß meine Landsleit net beleiding un mit jeden Drack iewer änn Lästen schlahn! Oder schprichst du epper in änn Zuhk von Harichsregener un Kaviar? Host racht: bädes kimmt schließlich of das Gleiche naus — Fischäer. Un doch wäß jeder, der ne ahnschtännige Zung hot, wie sichs im disse Dinger verhält. Un dodrmit, gläb ich, hätt ich eich dan Unnerschied zwischen dan beriehmten schtinketen Huhchschtapler, dar sich „echter Harzkäse" nennt, un dann ehrling Harzkaas klar genunk gemacht.
„Harzkäse", dos is änn Wort, dos all von sich aus ganz gemän klingt, su brät un schmärig. Un warsch härt, dar hält sich de Nos zu un denkt gleich an die muffing Dinger, die do hunnertewäs in klewwerige Kisten verpackt warn un die wie Schmär un Schmant ausänannerlaafen. Wenn ower der Kenner dos Wort Harzkaas ausschpricht, su saht harsch langsen un mit Liewe un Ahndacht: Harzkaas…
Har hauchts su hin un zieht de Ahngbraun huch. De Nosenfliechel fange ahn ze bewern un ze schnuppern, als eppne äne duftige un ahngenahme Vision kimmt. Dos ganse Gesicht schmunselt, un mr kann richtig sahn, wiene es Wasser in dn Mund zusamme läfft. Ich sah eich — dar Mensch wäß, wosde gut schmeckt!
Ower noch wos muß hier endlich mol viergebrocht warn. Wenn ihr gläbt, doß dos, wos ihr als „echten Harzkäse” aßt, iewerhaupt dann Harz ze sahn gekrehng hot, su muß mr eier kindlich Gemiet bewunnern. Gutgleiwigkeit erheht dan Apptitt, un desserhalb will ich eich bei eiern Glauhm lohßen.
Warsch ower härn will, dann will ichs ruhig verzehln, doß dar genannte Schtinker Harzluft ärscht aus zwäter un dritter Hand kriegt. Seine Geburtsschteht is erringdän Nast da unten in Land, Vieneborrig oder Ringelhäm — na, ich kenn die Kaasfabriken werklich net alle, wu aus mogern Quergel „echter Harzkäse” zerachtgequattert un gemanscht wärd un wu mr ne net bluß pfannewäs huhln kann, nä, zantnerwäs kann mr ne mit hämm namme, wenn mr Verwendung for su änn Quantum hot. Ach dos is bluß Kartuffelkaas, zwäe for zahn Pfeng, mit dan se of Ahnsichtskarten Witze un Reklame machen. Is net ze sahn, of wos alles dr Kitsch verfällt!
Su wos gitts bein richting Harzkaas alles net.
Harzkaas is ze schtols, als dass har sich in Fabriken harschtelln lätt. Als änn Edelarzeignis vertreht har keine Massenbehandlung. Har will liewevull ahngefaßt sein. Un desserhaleb is har bluß do drhämm, wu fläßige Fraansleit sich Mieh gahn, äne Delikatesse ahch mit Delikatesse zu behanneln. Do, wu braune Kieh in Schtall aus un ein giehn, wu an dr Hinnertihr de Kaashorte hängt un in dr Kich sauwerne Kaasnäppel un Millichsetten sehtiehn. Un su wos gitts bluß in dn Ewerharz!
Wenn drim äner mol Harzkaas assen will, muß har klähn un bescheiden in Holzhauer- oder Barkmannsschtuhm ahnkloppen uder mol vierschprachen in Zachen- un Ferschterheisern. Es sah ower käner, har wollte gleich änn paar Pfund hahn, oder gar änıı Mannel! Denn lachense dich aus. Denn du mußt wissen, doß dos, wosde do unten im Kaller in Kaastopp schtieht, Edelschtähn sänn. Se lachen dich aus un schmunseln trehch: Mr assene salwer garn!
Dennsu schtiehste do un wischt dr de Nos. Un host all getreimt von an kläne Nordheiser drzu — hm, Junge, dos is wos! Ower ich kanns schließlich mäne Landsleit net verdenken. Ahch in Ewerharz isses net annerschter als wie annerschtwu: Salwer assen macht fett!
Da wird soviel von Harzkuriositäten geschrieben und gesprochen. An alles Mögliche denken die Leute, an Klippen und Felsen, an krumme Bäume und was weiß ich. Einer hat Nashörner gesehen. Der andere hat sich mit nackten Brockenhexen herumgebalgt. Und einer will sogar das Moor haben leuchten sehen – der Lügen-Ekel. Von solchen Faxen erzählen sie einem etwas.
Was aber die richtigen Harzkuriositäten sind, die werden vergessen. Oder hat ein einziger von euch etwa mal etwas vom Harzkaas gelesen? Ich glaube es nicht. Allerhöchstens, dass in eurem Wurstblatt der Kaufmann Müller oder Schulz euch eine frische Sendung „echten Harzkäse“ mundgerecht macht und euch damit, wenn man so sagen will, Honig um’s Maul schmiert.
Ich will aber gleich vorweg nehmen, dass dieser sogenannte „Harzkäse“ nichts mit Harzkaas gemein hat. „Echter Harzkäse“ und Harzkaas sind zwei Dinge, die sich nicht in einem Atemzug aussprechen lassen.
Der erste stinkt – alle Jammer, und wie der stinkt! Der andere duftet.
Ihr seht also, dass da wohl ein Unterschied gemacht werden muß. Und da möchte ich auch entschieden darum gebeten haben. Ich lasse meine Landsleute nicht beleidigen und mit jedem Dreck über einen Leisten schlagen! Oder sprichst du etwa in einem Zug von Heringsrogen und Kaviar? Du hast recht, beides kommt schließlich auf das Gleiche raus – Fischeier. Und doch weiß jeder, der eine anständige Zunge hat, wie es sich um solche Dinge verhält. Und damit, glaube ich, hätte ich euch den Unterschied zwischen dem berühmten stinkenden Hochstapler, der sich “echter Harzkäse“ nennt, und dem ehrlichen Harzkaas klar genug gemacht.
„Harzkäse", das ist ein Wort, das schon von sich aus ganz gemein klingt, so breit und schmierig. Und wer es hört, der hält sich die Nase zu und denkt gleich an die muffigen Dinger, die da hunderteweise in klebrigen Kisten verpackt werden und die wie Schmiere und Schmutz auseinander laufen. Wenn aber der Kenner das Wort Harzkaas ausspricht, so sagt er es langsam und mit Liebe und Andacht: Harzkaas…
Er haucht es so hin und zieht die Augenbrauen hoch. Die Nasenflügel fangen an zu beben und schnuppern, als ob ihm eine duftige und angenehme Vision kommt. Das ganze Gesicht schmunzelt, und man kann richtig sehen, wie ihm das Wasser im Munde zusammen läuft. Ich sage euch — der Mensch weiß, was gut schmeckt!
Aber noch etwas muß hier endlich einmal vorgebracht werden. Wenn ihr glaubt, dass das, was ihr als „echten Harzkäse“ eßt, überhaupt den Harz zu sehen bekommen hat, so muß ich euer kindliches Gemüt bewundern. Gutgläubigkeit erhöht den Appetit und deshalb will ich euch bei eurem Glauben lassen.
Wer es aber hören möchte, dem will ich es ruhig erzählen, dass der genannte Stinker Harzluft erst aus zweiter und dritter Hand bekommt. Seine Geburtsstätte ist irgendein Nest da unten im Land, Vienenburg oder Ringelheim – na, ich kenne die Käsefabriken wirklich nicht alle, wo aus magerem Quark „echter Harzkäse“ zurechtgequaddert und gemanscht wird und wo man ihn nicht nur pfundweise holen kann, nein, zentnerweise kann man ihn mit heim nehmen, wenn man Verwendung für so ein Quantum hat. Ach das ist nur Kartoffelkäse, zwei Stück für zehn Pfennig, mit dem sie auf Ansichtskarten Witze und Reklame machen. Es ist nicht zum sagen, auf was alles der Kitsch verfällt.
So etwas gibt es beim richtigen Harzkäse alles nicht.
Harzkaas ist zu stolz, als dass er sich in Fabriken herstellen ließe. Als ein Edelerzeugnis verträgt er keine Massenbehandlung. Er möchte liebevoll angefaßt sein. Und deshalb ist er auch nur dort daheim, wo fleißige Frauen sich Mühe geben, eine Delikatesse auch mit Delikatesse zu behandeln. Dort, wo braune Kühe im Stall aus und ein gehen, wo an der Hintertür die Käsehorte hängt und in der Küche saubere Käsenäpfe und Milchsatten stehen. Und so etwas gibt es nur im Oberharz!
Wenn darum jemand einmal Harzkaas essen möchte, muß er klein und bescheiden in Waldarbeiter- und Bergmannsstuben anklopfen, oder einmal vorsprechen in Zechen- oder Försterhäusern. Es sage aber keiner, er wolle gleich ein paar Pfund haben, oder ein Mann! Dann lacht man ihn dich aus. Denn du mußt wissen, dass das, was da unten im Keller im Käsetopf steht, Edelsteine sind. Sie lachen dich aus und schmunzeln trocken: Wir essen ihn selber gern!
Dann stehst du da und wischst die die Nase. Und du hast schon geträumt von einem kleinen Nordhäuser dazu – Junge, das ist was! Aber ich kann es schließlich meinen Landsleuten nicht verdenken. Auch im Oberharz ist es nicht anders, als anderswo: Selber essen macht fett!
Text: Karl Reinecke-Altenau,
entnommen aus dem Buch „Die Schwalben von Toledo“,
Verlag der Heimatstube Altenau-Schulenberg,
Altenau, 2020, ISBN 978-3-00-066955-2
Wie iche mr ä Zesammetraffn mit de Nazichonahlparrekwachtr in dr Brahk vierschtell
„Hallo — Guten Tag! — Was machen Sie denn hier?”
„Glickauf, se sän ower neifahdrich!”
„Wie bitte?”
„Iche hoh gemähnt, dosse ahrtich neigierich sän!”
„Sie wissen doch, daß Sie sich hier im Nationalpark Harz befinden.”
„Freilich wäß ich dos. Iche bin all mit mei Grussevohtr hie iewerall rimmerhahrgeloffn un lahf ah suhlang wie iche noch lahb hie rim, wuh mir Ewerharzr genah genumme ahch hingehährn; in dr Brahk.”
„Es besteht nach der Nationalparkverordnung in diesem Bereich, wo Sie sich befinden, ein sogenanntes Wegegebot, ist Ihnen das nicht bekannt?”
„Freilich – ach suh! Ihr seid wull wechche von de Rähnscher, diese dn Name nohch wull von Amerika ähngefluhng hahn. Ohwr wuhrim seid ihr denn ähngndlich nett off'n Wahch, wie sich's for zivilisierte Leit gehährt. Iewerings, ihr seid zwäe un iche bin gans allähn hie!”
„Wir sind im Dienst und überwachen diesen Nationalparkbereich Bruchberg.”
„Suh, suh! Dos kann iche mr all vierschtelln, ohwr in Dienst tritt mr off'n Waldbuhdn wull nischt kaputt. Nochdrzu mit zesamme vier Fieß!”
„Hier geht es nicht um die Anzahl der Füße, sondern um Recht und Ordnung. Aber sagen Sie einmal, warum sprechen Sie eigentlich immerzu so ein merkwürdiges Deutsch?”
„Sieste, un dohdrmit kumme mr genah off dann richting Thema. Wahrde disse Schprohch noch nettemohl richtich vrschtieht, hot hie offn Bruchbarrich ähngndlich garnischt vrluhrn!”
„Wieso, was haben wir hier nicht verloren?”
„Kinnersch, Kinnersch, doh bricht juh balle de Walt zesamme. Sechche Leit, diede noch nettemohl unnere Schprohch vrschtiehn, wulln uns hie in unnerer Ewerharzr Heimot de Levietn lahsn. Na, suhweit wards denn wull nett kumme, ohwr missn mr sich arscht, nett bluhs mit dr Schnuht, orndich zu dr Wehr setzn?”
„Nun, nun! Bitte nicht aufregen, wir tun doch auch nur unsere Pflicht. Aber sagen Sie doch bitte einmal, was Sie hier in diese Wildnis treibt.”
„Freilich kann ich dos. Mir echtn ähngefleischtn Ewerharzr fiehln uns balle wie es Willbert. Mir kenne namlich uhne unnerer Brahk un unnerer ahngeschtammtn Heimot, wuhdrzu ahch dr Bruchbarrich mit sänner Wildnis drzugehährt, nett lahm, un wenn ich nohng Bruchbarrich kumm, denn traffiche in Gedankn eftersch dn Reinecke Karrel hie uhm un mach mich denn quarfaldähn ahch wiedr wack von hie. Kenne se denn dn Reinecke Karrel iewerhaupt?”
„Nein, aber das ist für unsere Aufgabe ja auch nicht wichtig?’
„Na — na! Dos sah iche ohwr annerschtr. Wahrde uns Ewerharzr wos vierenthaltn will, dahr mißte sich ähngndlich arschtemohl in Heimotkund sachkunnich machn, sist kanner unnere Mentalität un unnere Gefiehle ahch nett nohchvullziehn. Dr Reinecke Karrel hot sich ahch immer hie iewern Bruchbarrich wackgemacht, un wos dahr gefiehlt hot, mißter in sähne Bichr mohl nohchlahsn. Viellechcht kenntr denn vrschtiehn, wos iche mähn. Iewerings hohb iche dr Griefahne dohmohls geschriem un hohb off unnerer heimotling Lahmswähs hingewiesn. Es hot sich nett gemald un suh gieh iche dohdrvon aus, dosse mit unnerer Art ze lahm ähnvrschtandn gewahsn is. Alsuh, kähn Archr machn. Saht in eirer Dienstschteht Beschähd, dossr dn Weidemeier Farschtr aus Annerschbarrich getroffn hoht. Es währ schien, wenner mich es nahchstemohl mit „Glickauf” begrießn wiehrt. Lahbt wull un kimmt gut hämm.“
„Auf Wiedersehen, Herr Weidemeier!“
Glickauf, dr Farschtr
„Hallo — Guten Tag! — Was machen Sie denn hier?”
„Glückauf, Sie sind aber neugierig!”
„Wie bitte?”
„Ich hab gemeint, dass Sie richtig neugierig sind!”
„Sie wissen doch, daß Sie sich hier im Nationalpark Harz befinden.”
„Freilich weiß ich das. Ich bin auch schon mit meinem Großvater hier überall herumgelaufen und ich laufe auch solange ich lebe hier herum, wo wir Oberharzer genau genommen auch hingehören: in den Wald.”
„Es besteht nach der Nationalparkverordnung in diesem Bereich, wo Sie sich befinden, ein sogenanntes Wegegebot, ist Ihnen das nicht bekannt?”
„Freilich – ach so! Ihr seid wohl welche von den Rangern, die sie dem Namen nach wohl aus Amerika eingeflogen haben. Aber warum seid ihr denn eigentlich nicht auf dem Weg, wie sich's für zivilisierte Leute gehört. Übrigens, ihr seid zwei und ich bin ganz allein hier!”
„Wir sind im Dienst und überwachen diesen Nationalparkbereich Bruchberg.”
„So, so! Das kann ich mir schon vorstellen, aber im Dienst tritt man auf dem Waldboden wohl nichts kaputt. Noch dazu mit vier Füßen!”
„Hier geht es nicht um die Anzahl der Füße, sondern um Recht und Ordnung. Aber sagen Sie einmal, warum sprechen Sie eigentlich immerzu so ein merkwürdiges Deutsch?”
„Siehst du, und damit kommen wir genau auf das richtige Thema. Wer diese Sprache noch nicht einmal richtig versteht, hat hier auf dem Bruchberg eigentlich gar nichts verloren!”
„Wieso, was haben wir hier nicht verloren?”
„Kinder, Kinder, da bricht doch bald die Welt zusammen. Solche Leute, die noch nicht einmal unsere Sprache verstehen, wollen uns hier in unserer Oberharzer Heimat die Leviten lesen. Na, soweit wird's dann wohl nicht kommen, aber müssen wir uns erst nicht bloß mit dem Mund ordentlich zur Wehr setzen?”
„Nun, nun! Bitte nicht aufregen, wir tun doch auch nur unsere Pflicht. Aber sagen Sie doch bitte einmal, was Sie hier in diese Wildnis treibt.”
„Freilich kann ich das. Wir echten eingefleischten Oberharzer fühlen uns bald wie das Wild. Wir können nämlich ohne unsere Wälder und unsere angestammte Heimat, wozu auch der Bruchberg mit seiner Wildnis gehört, nicht leben, und wenn ich zum Bruchberg komme, dann treffe ich in Gedanken öfters den Reinecke Karl hier oben und mach mich dann querfeldein auch wieder weg von hier. Kennen Sie Karl Reinecke überhaupt?”
„Nein, aber das ist für unsere Aufgabe ja auch nicht wichtig?’
„Na — na! Das sehe ich aber anders. Wer uns Oberharzer was vorenthalten will, der müsste sich eigentlich erst einmal in Heimatkunde sachkundig machen, sonst kann er unsere Mentalität und unsere Gefühle auch nicht nachvollziehen. Karl Reinecke hat sich auch immer hier über den Bruchberg hinweg gemacht, und was er gefühlt hat, müsst ihr in seinen Büchern mal nachlesen. Vielleicht könnt ihr dann verstehen, was ich meine. Übrigens habe ich der Frau Griefahn damals geschrieben und hab auf unsere heimatliche Lebensweise hingewiesen. Sie hat sich nicht gemeldet und so gehe ich davon aus, dass sie mit unserer Art zu leben einverstanden gewesen ist. Also, keinen Ärger machen. Sagt in eurer Dienststelle Bescheid, dass ihr den Weidemeier Förster aus Andreasberg getroffen habt. Es wäre schön, wenn ihr mich das nächste Mal mit „Glückauf” begrüßen würdet. Lebt wohl und kommt gut heim..“
„Auf Wiedersehen, Herr Weidemeier!“
Glückauf, dr Farschtr
Text: K.-H. Weidemeier (Dr Farschtr).
Aus Harzbergkalender 1997, Seite 134.